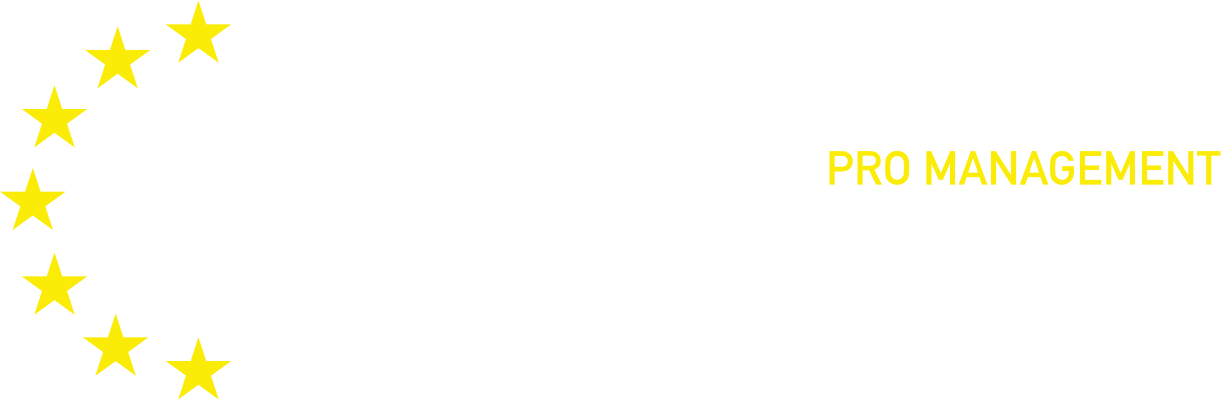Zur Präsenz und Absenz antiker Gestalten in der Kunst

Into the Labyrinth ©rabirius
Was sind Mythen eigentlich?
Mythen sind keine bloßen Erzählungen von längst vergangenen Zeiten, keine alten Märchen, die durch modernere Narrative ersetzt wurden. Sie sind verdichtete Weltdeutungen – Gleichnisse über Natur, Gesellschaft, Schuld, Macht, Begehren, Transformation. Die griechischen Mythen, aufgeschrieben, verändert, weitergegeben über Jahrhunderte, spiegeln zentrale Fragen der menschlichen Existenz: Woher kommen wir? Was ist der Mensch? Wo endet das Tierische? Wo beginnt das Göttliche?
Schon in der Antike und später in der Aufklärung versuchte man, den Ursprung dieser Mythen zu erklären – als allegorische Ausdeutung der Natur, als moralische Fabel, als verschlüsselte Geschichte realer Ereignisse oder einfach als Ausdruck menschlicher Fantasie. Doch nicht alle Mythen haben den Weg in das kulturelle Gedächtnis gleichermaßen gefunden. Manche Figuren – wie der Minotaurus oder Narziss – haben sich tief in das kollektive Bildrepertoire eingegraben, wurden in der Malerei, in der Literatur, im Film und in der Popkultur immer wieder neu interpretiert. Andere dagegen – etwa Lykaon – blieben randständig oder nahezu unsichtbar. Warum ist das so?
Minotaurus – das Tier im Menschen
Der Minotaurus ist eine der bekanntesten und zugleich rätselhaftesten Figuren der griechischen Mythologie. Der Mythos erzählt, wie Pasiphaë, die Gattin des kretischen Königs Minos, aus göttlicher Strafe heraus eine Leidenschaft für einen Stier entwickelt und mit dessen Hilfe – in einem hölzernen Kuhkostüm – den Minotaurus gebiert: ein Wesen mit dem Leib eines Menschen und dem Kopf eines Stiers. Um das Monstrum zu verstecken, lässt Minos das Labyrinth bauen. Dort wird der Minotaurus eingesperrt und regelmäßig mit Jünglingen aus Athen gefüttert – bis Theseus kommt, das Monster tötet und mit Hilfe des Fadens der Ariadne den Weg aus dem Labyrinth findet.
In dieser Geschichte verbinden sich Schuld, Sexualität, Gewalt, Macht und Isolation zu einem dichten Bedeutungsknoten. Der Minotaurus ist das „Andere“ schlechthin: halb Mensch, halb Tier, unheimlich und zugleich tragisch. Seine Gestalt lädt zur Identifikation ein – nicht zuletzt, weil er eingesperrt und gefüttert wird wie ein Verstoßener. Moderne Interpretationen – etwa bei Jorge Luis Borges – stellen nicht mehr den Helden in den Vordergrund, sondern das Monster: als Wesen, das denkt, leidet, träumt. Künstler wie Picasso oder Max Ernst sahen in ihm eine Projektionsfläche für das männliche Begehren, für Angst, Zärtlichkeit, Macht und Verletzbarkeit. Der Minotaurus wurde nicht nur zum Motiv, sondern zur Metapher.

The Shattered Image of Narcissus ©rabirius
Narziss – im Bann des eigenen Bildes
Auch Narziss gehört zu denjenigen Mythenfiguren, die eine erstaunliche Bildkarriere gemacht haben. Seine Geschichte ist vor allem durch Ovid überliefert: Narziss, der schöne Jüngling, der von allen geliebt wird, aber niemanden zurücklieben kann, weist die Nymphe Echo grausam ab. Zur Strafe lässt ihn die Göttin Nemesis sich selbst begegnen – als Spiegelbild im klaren Wasser eines Brunnens. Narziss verliebt sich in sein eigenes Antlitz, erkennt aber nicht, dass es nur ein Spiegelbild ist. Unfähig, sich davon zu lösen, vergeht er an seiner Selbstliebe. An der Stelle seines Todes wächst eine Blume: die Narzisse.
Diese Geschichte berührt etwas Grundsätzliches: die Beziehung des Menschen zu sich selbst. Narziss ist nicht einfach nur eitel – er ist gefangen in einem Bild, das nie wirklich berührt werden kann. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Selbsterkenntnis und Selbstverlust, zwischen Begehren und Unmöglichkeit, ist künstlerisch hoch anschlussfähig. In der Renaissance wurde Narziss zum Sinnbild der Vanitas, der Vergänglichkeit von Schönheit. In der Psychoanalyse wurde er zur Figur des pathologischen Narzissmus.
Heute begegnet uns der Mythos in digitaler Gestalt wieder – in der Selfie-Kultur, im endlosen Scrollen durch perfekt inszenierte Selbstbilder. Das Smartphone wird zum Wasserbecken, das Display zum Spiegel. Der Narziss-Mythos lebt weiter im sozialen Blick, im Wunsch, gesehen zu werden, und in der Gefahr, sich selbst dabei zu verlieren. Gerade deshalb bleibt Narziss eine zentrale Figur moderner Selbstverhältnisse – und ein permanenter Reflexionspunkt für die Kunst.

Lycaon’s Feast ©rabirius
Lykaon – das Tier als Strafe
Anders liegt der Fall bei Lykaon. Der Mythos ist düster, archaisch, von fast biblischer Härte. In Ovids Metamorphosen will König Lykaon, misstrauisch gegenüber der Göttlichkeit seines Gastes, diesen auf die Probe stellen – indem er ihm das Fleisch eines geopferten Menschen serviert. Doch der Fremde ist Zeus. Der Göttervater erkennt die Entweihung, schleudert einen Blitz in das Haus des Frevlers und verwandelt Lykaon zur Strafe in einen reißenden Wolf. Eine Metamorphose von erschreckender Konsequenz: Das Menschliche wird nicht nur bestraft, sondern vollständig entzogen – ersetzt durch das Tier, das Lykaon innerlich längst war.
Doch der Mythos endet nicht hier. Die Episode markiert den Wendepunkt, an dem Zeus endgültig den Glauben an die Menschheit verliert. Lykaons Tat wird zum Auslöser der großen Flut – jener mythischen Katastrophe, mit der die alte Menschheit ausgelöscht wird.
Trotz dieser Wucht blieb Lykaon in der bildenden Kunst eine Randfigur. Vielleicht, weil seine Geschichte keine Heldenreise kennt. Keine Reue, keine Läuterung, kein Trost. Nur Entmenschlichung. Vielleicht auch, weil sie zu sehr an etwas erinnert, das wir lieber verdrängen: den Verrat an der Gastfreundschaft, den Tabubruch des Kannibalismus, die Nähe zum Tier im Menschen. Während der Werwolf als Figur längst zur Ikone der Popkultur wurde, blieb Lykaon – sein mythologischer Ursprung – weitgehend unbeachtet. Er ist eine Leerstelle. Und genau darin liegt seine künstlerische Herausforderung.
Warum bleiben manche – und andere nicht?
Welche Mythen in der Kunst überdauern, hängt nicht nur vom Erzählwert ab, sondern von ihrer Offenheit, von der Projektionskraft der Figuren. Der Minotaurus lässt sich als Monster, Opfer, Symbol oder Spiegelbild innerer Zerrissenheit lesen – ein Motiv, das in der Kunst immer wieder neu inszeniert wird. Narziss hingegen stellt die existentielle Frage nach Identität und Selbstwahrnehmung – er bietet eine universelle Bühne für psychologische und ästhetische Auseinandersetzung.
Lykaon dagegen bleibt starr in seiner Grausamkeit. Er ist weder tragisch noch schön. Seine Geschichte entzieht sich dem klassischen Heldennarrativ – es gibt keine Katharsis, keine Läuterung, kein Mitleid. Vielleicht ist das der Grund für seine Auslassung.
Doch gerade in dieser Leerstelle liegt eine Chance: Die Kunst war und ist nicht nur Spiegel des kulturellen Gedächtnisses, sondern auch ein Möglichkeitsraum. Sie kann blinde Flecken beleuchten, Ausgelassenes neu ins Spiel bringen. Die Rückkehr solcher randständigen Gestalten kann mehr sein als Rehabilitierung – sie ist eine Einladung, die kulturelle Ordnung der Bilder selbst zu hinterfragen. Was wurde verdrängt? Was gilt als zeigbar, was als unsagbar? Welche Narrative erscheinen anschlussfähig – und welche stören?
In einer Zeit, in der die Grenzen zwischen Mensch und Tier, Instinkt und Ratio, Natur und Kultur zusehends verschwimmen, wird gerade das Unbequeme wieder interessant. Die Kunst kann diese Ambivalenzen sichtbar machen – nicht, um sie aufzulösen, sondern um sie auszuhalten. Sie hat das Potenzial, die Schattenfiguren ins Licht zu rücken – und damit die Mythen selbst weiterzuerzählen.
Kai Prager ist ein kreativer Allrounder, der als Literaturwissenschaftler, Marketing- und PR-Spezialist sowie Entwickler tätig ist. Unter dem Künstlernamen rabirius entfaltet er auch seine künstlerische Seite als Musiker (mockART) und Fotograf. Seine Kunstwerke, insbesondere seine Kollagen, entstehen durch raffinierte Überblendtechniken und werden aus verschiedenen Versionen zusammengefügt.