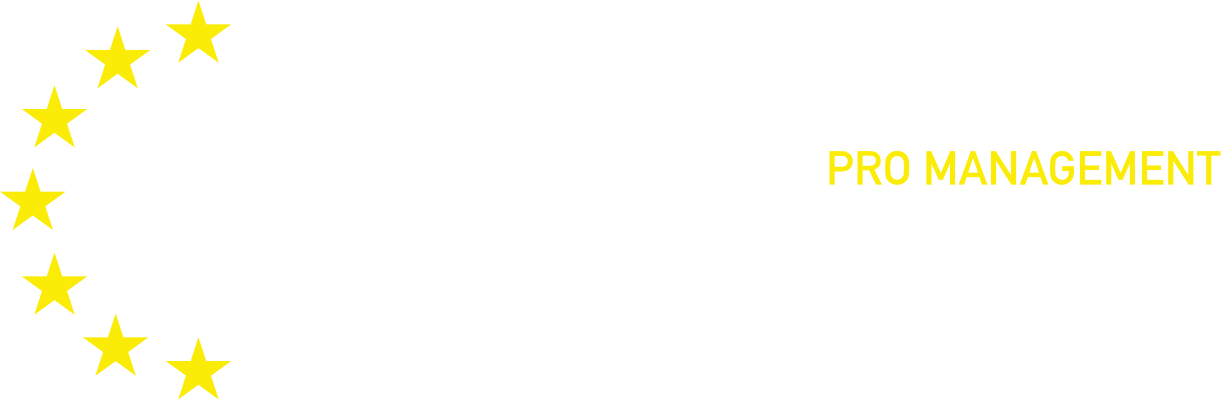Donald Tusk, lange bekannt als liberaler Europäer, Pragmatiker und machtbewusster Politiker, zeigt nun eine neue Facette: den Hüter der Grenze. Mit den Worten „In Polen wird es keine Umsiedlung von Migranten geben – und das bleibt so“ verkörpert er jene Mischung aus Selbstgewissheit und kalkulierter Schärfe, die Brüssel nervös macht und die polnische Bevölkerung zugleich beglückt. Nach zähen Verhandlungen steht fest: Polen wird von den zentralen Verpflichtungen des EU-Migrationspakts ausgenommen. Doch dies ist kein glücklicher Zufall, sondern Ausdruck eines nüchternen, europäischen Realismus.
Was auf den ersten Blick wie eine juristische Ausnahme erscheint, entpuppt sich als politischer Paukenschlag. Brüssel erkennt Polen als Land „unter besonderem Migrationsdruck“ an – ein Etikett, das nicht nur von Aufnahmeverpflichtungen entbindet, sondern auch frische Mittel aus dem europäischen Solidaritätsfonds in Aussicht stellt. Die Begründung ist einfach: Polen hat seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs mehr Flüchtlinge aufgenommen als jedes andere EU-Land und steht zugleich an einer Grenze, die Minsk und Moskau als Instrument geopolitischer Manipulation nutzen. Ein doppelter Ausnahmezustand – und der ideale Hebel, um Brüssels Umverteilungsquoten zu umgehen.
Tusk inszeniert sich dabei als Mann der Tat in einer Union der Zauderer. Polen, so sein Credo, sei zum „Vorbild Europas“ geworden: die Ostgrenze gesichert, die Asylgesetze verschärft, bürokratische Verfahren beschleunigt. „Wir tun, nicht reden“ – dieser Satz wirkt nicht nur als politischer Schlachtruf, sondern als Manifest der Effizienz gegenüber Brüssel. Wer sich durchsetzen will, muss offenbar mit der Faust auf den Tisch schlagen – und darf den Zeigefinger nach Osten richten.

Foto von www.pixabay.com
Der 2024 verabschiedete Migrations- und Asylpakt sollte Ordnung ins Chaos bringen. Doch das Chaos war nie das Problem – es war die Einigkeit, die fehlte. Der sogenannte Solidaritätsmechanismus, der Aufnahmepflichten oder Zahlungen vorsah, wurde von Warschau, Budapest und Bratislava von Beginn an als moralischer Ablasshandel kritisiert. Tusk hat diese Kritik nicht erfunden, doch er hat ihr Gewicht verliehen. Mit seiner „Pro-Europa“-Fassade formuliert er diplomatisch, was andere seit Jahren lauthals rufen: Europa hat die Kontrolle über seine Grenzen verloren – wer sie wiederfinden will, muss die Schranken ziehen.
Unterstützt wird Tusk vom Präsidenten Karol Nawrocki, der in einem Brief an Ursula von der Leyen erklärte, Polen werde keine Maßnahme akzeptieren, die eine Zwangsumsiedlung vorsieht. Stattdessen müsse Europa die Ursachen bekämpfen – Armut, Krieg, Schleuser. In Warschau wird dies zur Verteidigungsdoktrin erhoben: Die Ostgrenze ist seit 2021 ein neuralgischer Punkt europäischer Sicherheit, an dem Polen seine Rolle als Bollwerk der Zivilisation ausspielt und daraus politisches Kapital schlägt.
Ironischerweise marschierte am selben Wochenende auch die PiS-Partei durch Warschau – ausnahmsweise in Einklang mit Tusks Linie. Partei- und Regierungsinteressen vereinen sich gegen Brüssel. Polen präsentiert sich erneut als Europas Renegat mit Begründung. Für die EU ist dies zugleich ein Segen und ein Dilemma – Wer die Aufnahme verweigert, muss auch keine neuen Quoten aushandeln. Realpolitik übertrumpft manchmal den Idealismus.
Tusks Erfolg ist innenpolitisch brillant, europapolitisch riskant. Polen sendet eine klare Botschaft: Solidarität ist verhandelbar, solange man entschlossen genug verhandelt. Brüssel wird den Vorgang als pragmatische Lösung verkaufen, Warschau feiert ihn als Beweis, dass nationale Interessen in einer supranationalen Union Gewicht haben. Zwischen beiden Lesarten liegt die Zukunft Europas – irgendwo zwischen Überzeugung und Überforderung. Und vielleicht ist genau dies Tusks Absicht, nämlich keinen Bruch mit Europa provozieren, sondern die Erinnerung daran, dass man auch als Europäer noch „Nein“ sagen darf.