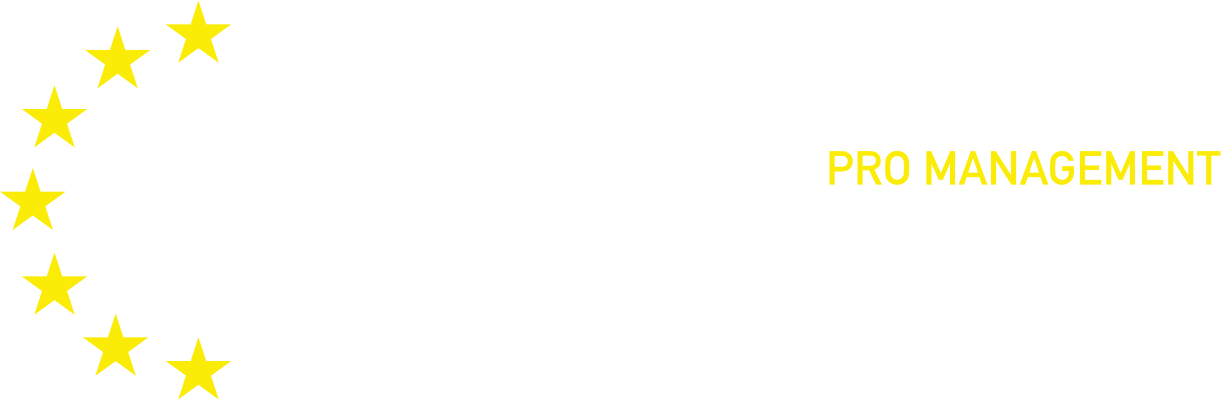In der Podiumsdiskussion „Wie innovativ ist Europa?“ wurde aber auch klar: Innovation beginnt zuerst im Kopf
Bei den Neudrossenfelder Europatagen stehen natürlicherweise die Übergaben von FEK-Europamedaille Kaiser Karl IV. und FEK-Freiheitsring im Vordergrund. Daneben sind historische und politische Vorträge aber seit jeher ein traditioneller Bestandsteil der Veranstaltung im Rotmaintal. In diesem Jahr konnte den interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Zusammenarbeit mit der FEK-Partnerorganisation Diplomatic World Institute (DWI) aus Brüssel zudem eine besondere Podiumsdiskussion präsentiert werden.
Dieter Brockmeyer, der Director TIME & INNOVATION des DWI, leitete im Gontardsaal des Neudrossenfelder Schlosses einen bemerkenswerten Dialog zwischen zwei maßgeblichen Vertreterinnen des europäischen Betriebs. Die beiden Vollblutpolitikerinnen, die das Frankfurter Mitglied der EUROjournal Chefredaktion ins Gespräch brachte, hätten für die Fragestellung „Wie innovativ ist Europa?“ nicht geeigneter sein können: Monika Hohlmeier als Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses des Europäischen Parlaments und Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank. Beide Politikerinnen verbindet neben der Arbeit im Europaparlament (Beer war dort bis zu ihrem Weggang nach Luxemburg Vizepräsidentin) auch langjähriges Engagement als Kultusministerin ihres jeweiligen Heimatlandes – Hohlmeier (CSU) in Bayern, Beer (FDP) in Hessen. Nicola Beer verfügt darüber hinaus über Erfahrungen in der Bundespolitik als Mitglied des Deutschen Bundestages und langjährige Generalsekretärin ihrer Partei. Beide Politikerinnen sind auch Trägerinnen der FEK-Europamedaille, Monika Hohlmeier erhielt die Auszeichnung bei den Europatagen 2023, Nicola Beer in diesem Jahr.

Gut gelaunt, aber stets Klartext sprechend, entführte das Panel mit Monika Hohlmeier (links), Nicola Beer (rechts) und Gesprächsleiter Dieter Brockmeyer die Gäste des Europakolloquiums in die Fragestellung „Wie innovativ ist Europa?“ (Foto: Johannes Breyer).
Ob in Brüssel oder Luxemburg: aktives Gestalten „macht unheimlich Spaß“
Der Leiter der Diskussion, dessen im Vorjahr in der Publikationsreihe des DWI erschienenes Buch „Campus mundi“ den Vortragenden und Ehrengästen als Geschenk zur weiteren Vertiefung überreicht wurde, stellte zunächst das DWI vor, das 2019 u.a. vom aus Frankfurt/Main stammenden Innovationsexperten mitgegründet wurde. Die Thematik rund um „Innovation“ sei schon deshalb wichtig, weil sich in der rasantem Wandel unterworfenen Gesellschaft große Teile der Bevölkerung einer gewissen Unsicherheit gegenübersehen. „Damit müssen wir umgehen,“ meinte der Autor der EUROjournal Serie „Alter, weiser Mann“, in der er immer wieder augenzwinkernd die menschliche Seite der Veränderung unserer Gesellschaft beleuchtet, da sich die „Effekte dieser Entwicklung in den nächsten Jahren noch verstärken werden.“ Überbürokratisierung spiele eine große Rolle bei diesem Missempfinden der Menschen, sprach Brockmeyer sogleich die beiden Gesprächspartnerinnen an, sei doch versprochen worden, für jede neue Regelung eine andere einzusparen. In diesem Zusammenhang brachte er die gerade aus der „Kontrollinstanz“ Europäisches Parlament ins „operative Geschäft“ gewechselte Vizepräsident der EIB, Nicola Beer, in die Diskussion. Die ehemalige Vizepräsidentin des Parlaments widersprach, denn das Parlament würde immer mehr auch Gesetzesinitiative übernehmen und seine Vorstellungen Kommission und Rat deutlich machen. Sie ging im Folgenden auf die Arbeit von Europäischer Investitionsbank und dem damit in Verbindung stehenden Investitionsfonds ein.

Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Innovationsbank, vermittelte in ihren Redebeiträgen große Freude am Mitgestalten Europas (Foto: Wolfgang Otto).
Alle 27 Mitgliedsstaaten seien die Anteilseigner dieser Bank und würden insbesondere bei noch nicht vom Markt übernehmbaren Risiken einstehen. „Wir gehen überall dort hinein, wo sich keine Geschäftsbank hineintraut,“ beschrieb Beer die Arbeit der von ihr vertretenen Institution. „Das macht unheimlich Spaß,“ erläuterte die gebürtige Wiesbadenerin insbesondere die Beratung von Parlament, Kommission und Rat zum Thema Kosten- und Zeiteffizienz.
Wider die Misstrauenskultur
Hier bezog der Moderator die Europaparlamentarierin Monika Hohlmeier ein, die bedauerte, dass in der letzten Legislaturperiode die Menge an Regularien sogar noch zugenommen habe. „Dabei weiß doch jeder, dass Innovation nicht nur mit Kontrolle, sondern vor allem mit Innovationsgeist funktionieren sollte.“ Insbesondere hätten da die so genannten Nichtregierungsorganisationen in den letzten Jahren eine eher innovationsfeindliche Stimmung befeuert. Dies sei gefährlich, denn ohne Innovation und Innovationsförderung seien keine Start-up-Gründungen im nötigen Umfang denkbar. „Wir werden sehr viel korrigieren müssen,“ sprach die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses u.a. das „Naturwiederherstellungsgesetz“ an. Viele der Regelungen dort würden bereits von zahlreichen anderen Verordnungen und Gesetzen vorgegeben sein, erschwerten der Wirtschaft aber zusätzlich ihr Handeln. „Es entsteht hier eine Misstrauenskultur, mit der das Klima sicher nicht gerettet werden kann,“ warnte die Politikerin vor einer in Teilen subversiven Blockadehaltung verschiedener in die Gesetzgebung involvierter Lobbyeinrichtungen, die nur noch im höchsteigenen Interesse agierten.

Die Vollblutpolitikerin Monika Hohlmeier überzeugte mit klarer Argumentation und pointierten Aussagen einmal mehr das Publikum bei den Neudrossenfelder Europatagen (Foto: Wolfgang Otto)
Hier sprach der Innovationsexperte das „heikle Thema“ Künstliche Intelligenz an. Hohlmeier trat dem locker entgegen: „Ob wir es wollen oder nicht, die KI ist da,“ verdeutlichte die Lichtenfelserin die Notwendigkeit problematische Felder von unproblematischen zu identifizieren. Das sei Aufgabe u.a. des Zusammenspiels der Europäischen Institutionen, mit viel Dynamik im Spiel.
33 Billionen Euro Potential „liegen“ in der EU
Förderung von Start-ups sei eine ganz besondere Aufgabenstellung, mahnte Dieter Brockmeyer mit Blick auf die EIB an. Hier gab Nicola Beer zu bedenken, dass in den Konkurrenzmärkten von Indien, China bis hin zu den USA der Markt übersichtlicher sei und damit für Investoren einfacher zu bespielen. Bei 27 Mitgliedsstaaten sei die EU hier im Nachteil, eine Fragmentierung, die u.a. mit der Arbeit der Investitionsbank gelindert werden soll. Auf diese Weise sollen die Ideen, die tatsächlich weitgehend in Europa entwickelt werden, auch in der Umsetzung hier gehalten werden. „33 Billionen Euro Sparguthaben liegen auf den europäischen Konten,“ machte die Vizepräsidentin klar, dass die Investitionsvorhaben durch privates Kapital in Zukunft mehr gefördert werden könnten und sollten. Der erste europäische Innovationsfonds zu neuen Technologien sei bereits erfolgreich implementiert worden – mit Vorteilen für den Innovationsstandort Europa, aber auch für die Anleger, die sich aus allen Gesellschaftsschichten rekrutierten. Ein Umdenken sei hier auch bei den europäischen Behörden erforderlich, wo etwa das Kartellamt noch vor wenigen Jahren im Zusammenhang mit großen internationalen Plattformen in den bewegten Datenmengen keinen adäquaten Gegenwert sahen,“ warf Monika Hohlmeier ein. Die Möglichkeiten für „crowd funding“ sollten nach dem Vorbild USA auch für die EIB ausgebaut werden. Dabei müsse klar sein, dass Investitionen in Innovationen nie risikofrei sein könnten.
Kontrolle ist gut, Kooperation ist essentiell
Dies sei nicht nur auf der Investorenseite zu beachten, sondern auch im Umgang der Bevölkerung mit dem Thema Innovation, kam Dieter Brockmeyer auf die Bedeutung des Themas für die breite Mehrheit zu sprechen. Hier sei in erster Linie ein neuer Geist im Umgang miteinander erforderlich.

Der Innovationsexperte Dieter Brockmeyer vom Diplomatic World Institute (Brüssel) führte Gesprächspartnerinnen und Publikum sicher durch das Thema des Nachmittags (Foto: Wolfgang Otto).
„Wir brauchen in erster Linie Kooperation und nicht nur Kontrolle,“ mahnte Monika Hohlmeier an, dass die Entwicklungen der letzten Jahre zahllose Probleme auf die Gesellschaft zukommen lassen. Schnell war man bei dieser Problematik wieder bei den Themen Überbürokratisierung und Digitalisierung angelangt. „Man muss aus einer Anzeigepflicht in Europa keine Kontrollpflicht in Deutschland machen,“ sieht die Tochter des einstigen Bayerischen Ministerpräsidenten in der nahezu ubiquitären Verschärfung aller Europagesetze in deutschen Verordnungen als wesentlichen Unterschied zur Aufbruchsstimmung der 1960er Jahre. Hier bestand, wie so oft an diesem Nachmittag, Konsens zwischen den beiden Damen. „Das Vorsorgeprinzip sollte in Zukunft unbedingt mit einem Innovationsprinzip bei gesetzlichen Regelungen für das Wirtschaftsleben kombiniert werden,“ ergänzte Nicola Beer. Die Zeiten, „Gürtel und Hosenträger gleichzeitig zu tragen“ sollten auch in Deutschland bald der Vergangenheit angehören. Nur so seien die vielen herausragenden Forschungsleistungen auf unterschiedlichen Gebieten – nicht nur in Medizin und Raumfahrt – nicht in Gefahr, generell oder zumindest dem europäischen Innovationsmarkt verloren zu gehen, gab die Vizepräsidentin einige sehr zukunftsträchtige Beispiele an. Sie ermunterte dazu, etablierten Grund zu verlassen, tatkräftiges Handeln ist an der Reihe – „und weniger Bedenkenträgertum“, wie die oberfränkische Vertreterin im Europäischen Parlament, Monika Hohlmeier, ergänzte.
Hier liegt wohl auch der größte Anspruch, aber auch der bedeutsamste Hemmschuh, dem sich Innovation heute gegenübersieht. Dr. Ingo Friedrich, der Grand Seigneur der deutschen Europapolitik, ergänzte hierzu in der abschließenden Diskussionsrunde im Plenum zurecht, dass sich auch die Medien aufgerufen sehen sollten, Innovation mit positiven Fallbeispielen zu unterstützen.
Vom Leiter der Chefredaktion Prof. Dr. Wolfgang Otto