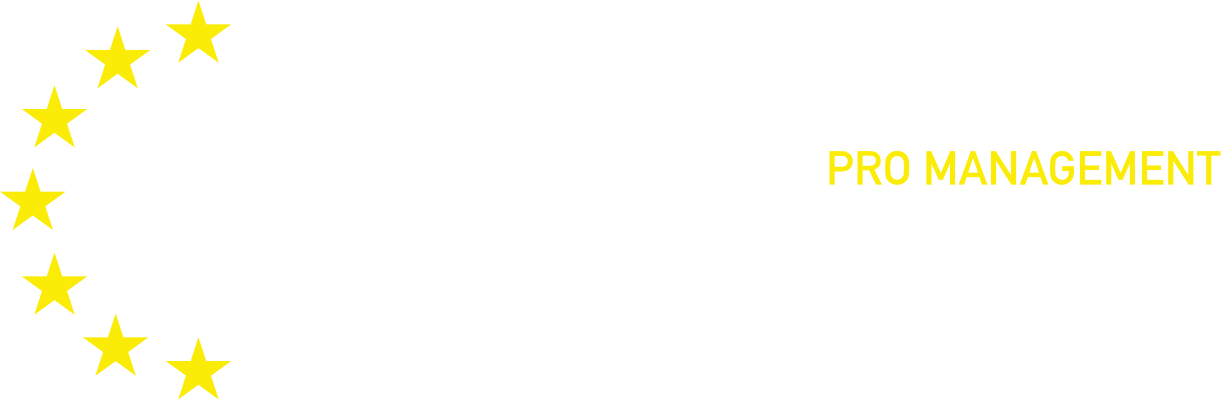„Im Namen desselben Volkes, das Marine Le Pen aller Voraussicht nach zur französischen Präsidentin wählen würde, wurde ihr gerade von einer Pariser Strafkammer die Kandidatur untersagt“, witzelte MdEP Martin Sonneborn. Sollte Le Pen nicht das Glück haben, im Ergebnis des beschleunigten Berufungsverfahrens 2026 in zweiter Instanz freigesprochen zu werden, könnte sich ihre Verurteilung vom 31. März 2025 als entscheidend für das endgültige Scheitern ihrer Ambitionen auf das Amt der Präsidentin der Republik erweisen. Denn wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder (durch Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im EU-Parlament) wurde sie in erster Instanz nicht nur zu einer Geldstrafe sowie einer Haftstrafe von vier Jahren (zwei auf Bewährung, zwei Jahre lang muss sie eine Fußfessel tragen) verurteilt, sondern sie verlor auch mit sofortiger Wirkung das passive Wahlrecht für fünf Jahre.
Letzteres verleiht Le Pens Verurteilung – die sich ansonsten einreihte in eine Reihe strafrechtlicher Verfahren und Verurteilungen mit durchaus politischer Brisanz wie etwa im Fall Nicolas Sarkozy – in den Augen vieler den Rang einer ‚Verfassungskrise‘ in dem Sinne, dass eine justizielle Entscheidung in massiver Weise in einen für die Republik zentralen demokratischen Entscheidungsprozess eingreift, gerade weil es sich bei Le Pen nicht um irgendeine aussichtsreiche Kandidatin handelt: Seit 2017, als sie erstmals in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl gelangte (und damals bereits gegen Emmanuel Macron antrat), gilt die Galionsfigur des RN als die programmatische Alternative zu einem zentristischen Präsidenten, der die Mehrheit der Franzosen 2017 wie 2022 für sich mobilisieren konnte, der aber von rechten wie linken Populisten stets als Verkörperung des ‚liberalen Systems‘ verteufelt wurde, dessen Repräsentanten die Respektierung demokratischer Verfahrensweisen lediglich vortäuschten.
In dieser Perspektive ist die nunmehrige Inéligibilité (Unwählbarkeit) Le Pens nicht nur für deren politischen Ziehsohn, den derzeitigen RN-Chef Jordan Bardella, ein gefundenes Fressen. Bardella attackiert eine „Tyrannei der Richter“ und eine „Hinrichtung der französischen Demokratie“. Aber auch ein Nationalkonservativer wie Éric Ciotti, der einst an der Spitze der CDU/CSU-Schwesterpartei Les Républicains stand, zieht den demokratischen Charakter Frankreichs in Zweifel. Jean-Luc Mélenchons LFI nahm im konkreten Fall ebenfalls für Le Pen Partei: Es stehe, so der Islamogauchist Mélenchon, (nur) dem Volk, nicht den Richtern, zu, „einen Abgeordneten zu entmachten“. Der Schulterschluss zwischen LFI und RN führt erneut die politisch-kulturellen Bruchlinien innerhalb der Linken vor Augen: Die anderen Linksparteien ließen keinerlei Zweifel daran, dass sie die Gerichtsentscheidung als einen Ausdruck der Herrschaft des Rechts begrüßen.
Ungeachtet dessen, dass Macron klarstellte: „Die Justiz entscheidet in aller Unabhängigkeit, und dies ist als Pfeiler unserer Demokratie zu respektieren“, und Premierminister François Bayrou wie Justizminister Gérald Darmanin Richter und Staatsanwälte gegen ihre aggressive ‚Delegitimierung‘ in Schutz nahmen, macht sich jedoch auch im Regierungslager ein Unwohlsein im Hinblick auf die weitreichenden staatspolitischen Konsequenzen der Jurisdiktion, soweit diese auch die Aberkennung politischer Rechte betrifft, bemerkbar. So äußerte Bayrou vor der Nationalversammlung sein Unbehagen mit Blick auf eine Gesetzeslage, die einen Ausschluss von einer Kandidatur in der Präsidentschaftswahl 2027 ermöglichte, ohne dass es dem oder der Betroffenen garantiert wäre, dagegen wirksam Berufung einlegen zu können (was allerdings nun durch das beschleunigte Berufungsverfahren durchaus der Fall zu sein scheint). Diesen Missstand zu beheben, obläge dem Gesetzgeber auf nationaler Ebene – unabhängig davon, dass Le Pen neben dem Verfassungsrat auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) – dessen Autorität sie prinzipiell nicht uneingeschränkt anerkennt – anrief, um „einstweiligen Rechtsschutz“ zu erlangen.