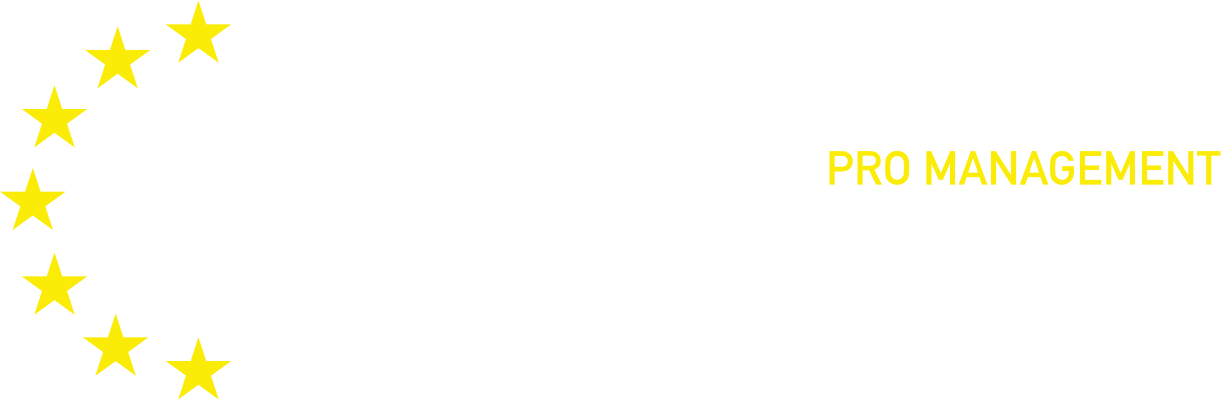Öl ins Feuer – Konflikt um Ostsee-Bohrungen vor Usedom
Deutschland und Polen sind nicht nur unmittelbare Nachbarn, sondern auch enge Handelspartner. Beide Länder sind wirtschaftlich stark verflochten – Deutschland ist Polens wichtigster Exportmarkt, Polen wiederum ein bedeutender Zulieferer für deutsche Industrie und Handel. Dennoch gibt es immer wieder Konflikte, wenn nationale Interessen aufeinanderprallen. Zuweilen erinnern die Beziehungsgeflechte beider Länder an das Aprilwetter. Ein aktueller Streitpunkt: die geplante Öl- und Gasförderung vor der polnischen Ostseeküste nahe der deutschen Ferieninsel Usedom. Während Polen in dem Projekt eine Chance auf mehr Energieunabhängigkeit sieht, warnt Mecklenburg-Vorpommern vor erheblichen Risiken für Umwelt und Tourismus.

Vor Swinemünde, unweit der Grenze zu Deutschland, hat das kanadische Unternehmen Central European Petroleum (CEP) nach eigenen Angaben eines der größten Öl- und Gasvorkommen in Polen seit dem Zweiten Weltkrieg entdeckt: Über 33 Millionen Tonnen Öl und 27 Milliarden Kubikmeter Gas – umgerechnet rund 200 Millionen Barrel Öl-Äquivalent – sollen im Offshore-Feld „Wolin East“ lagern. Erste Bohrungen erfolgten bereits 2024. Mecklenburg-Vorpommern wurde jedoch nicht offiziell informiert, obwohl eine deutsch-polnische Vereinbarung vorschreibt, bei Projekten mit potenziell grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen die Nachbarseite einzubeziehen.
Umweltminister Till Backhaus (SPD) verurteilt die Pläne scharf. Er spricht von einer „klimapolitisch rückwärtsgewandten Industriepolitik“ und sieht massive Gefahren für die Natur und die Wirtschaft der Region. Lärm, Bodenabsenkungen, Grundwasserverunreinigungen und Schäden an Flora und Fauna seien ebenso denkbar wie ein irreversibler Imageschaden für den Tourismus, der für Usedom der wichtigste Wirtschaftszweig ist. Backhaus fordert vom neuen Bundesumweltminister Carsten Schneider eine klare Stellungnahme gegenüber Warschau und betont, Mecklenburg-Vorpommern setze auf Sonne, Wind und Biomasse statt auf fossile Energien in der Ostsee.
Die Energiebranche sieht die Entwicklung differenzierter. Ludwig Möhring, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG), verweist auf die Chancen für Polen, den hohen Importbedarf an Energie – insbesondere bisher aus Russland – zu senken. Vier bis fünf Prozent des polnischen Ölbedarfs könnten für mehrere Jahre aus dem Fund gedeckt werden. Indirekt profitiere auch Deutschland, da der europäische Gasmarkt eng vernetzt ist. Eine höhere Eigenproduktion in Polen könne die Preise stabilisieren und den Bedarf an teureren Importen, etwa von CO₂-intensivem Flüssiggas aus den USA, verringern.
Ob sich das Vorkommen bis in deutsche Hoheitsgewässer erstreckt, ist noch unklar. Kohlenwasserstoffe vor Usedom sind zwar bekannt, werden jedoch aus wirtschaftlichen und technischen Gründen derzeit nicht gefördert. Ähnliche Debatten gibt es um ein grenzüberschreitendes Gasfeld vor Borkum sowie neue Projekte in Niedersachsen. Befürworter verweisen auf strenge Umweltauflagen und moderne Fördertechnik, Kritiker auf die Gefahr dauerhafter Schäden für sensible Ökosysteme und Küstenregionen.
Der Fund vor Wolin wirft nicht nur Fragen zur Energiepolitik auf, sondern auch zu Transparenz, Zusammenarbeit und Vertrauen zwischen Deutschland und Polen. Während Warschau auf wirtschaftliche und energiepolitische Vorteile setzt, fürchtet Mecklenburg-Vorpommern um Umwelt und Tourismus. Die Kontroverse verdeutlicht die schwierige Balance zwischen Energieversorgungssicherheit, wirtschaftlichen Interessen und Klimaschutz – und sie zeigt, wie sensibel nachbarschaftliche Beziehungen werden können, wenn Ressourcen im Spiel sind.
Von Kollegiumsmitglied Arthur Vorreiter