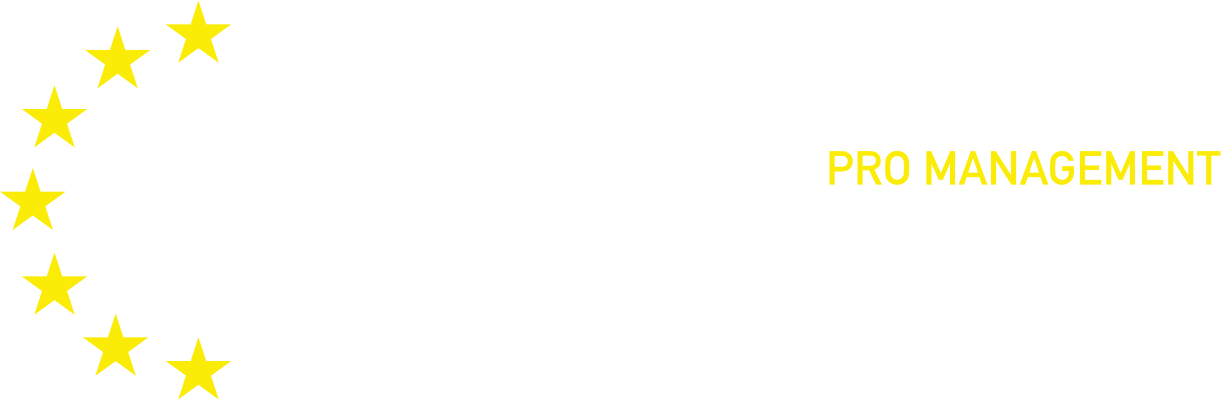Am 2. September 2021 verstarb der griechische Komponist, Dichter und Widerstandskämpfer Mikis Theodorakis im Alter von 96 Jahren. Die griechische Regierung ehrte Theodorakis mit einer dreitägigen Staatstrauer. Dabei würdigte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis den Verstorbenen im Hinblick auf dessen Ansehen, das er sich als Komponist wie als Politiker lagerübergreifend – in Griechenland und weltweit – erwarb, mit den Worten: „Seine Stimme ist verstummt und mit ihr alle Griechen weltweit.“

Theodorakis wurde am 29. Juli 1925 auf Chios geboren als Sohn eines aus Kreta stammenden Staatsbeamten und einer wenige Jahre zuvor aus ihrer kleinasiatischen Heimat vertriebenen Griechin. Als Griechenland der Aggression Hitler-Deutschlands, das im April 1941 dem militärisch erfolglosen Italien zur Seite sprang, zum Opfer fiel, studierte der jugendliche Theodorakis am Athener Konservatorium. Während der Okkupation schloß Theodorakis sich der Volksbefreiungsarmee ELAS an; als 18-Jähriger erlitt er erstmals Gefangenschaft und Folter. Im Bürgerkrieg (1946-49) trat er als Parteigänger der Linken, die sich militärisch der monarchischen Restauration des Landes entgegenstellte, erneut unter Einsatz seines Lebens und seiner Gesundheit für seine politischen Überzeugungen ein – was ihm 1952 eine Verbannung auf Makronisos einbrachte und ihn anschließend ins Pariser Exil zwang, wo er sein Musikstudium fortsetzte.
Nach seiner Rückkehr nach Athen 1960 wurde Theodorakis zum „Lead-Sänger eines freien Griechenlands“, zum „Volkstribun mit musikalischen Mitteln“ (Gerhard R. Koch). In dieser Phase begründete die Musik zu Michael Cacoyannis’ „Alexis Sorbas“ (1964) seinen Weltruhm. 1966 brachte er gemeinsam mit Maria Farantouri den „Mauthausen-Liederzyklus“ zu Ehren der Opfer faschistischer Barbarei hervor. Ein Jahr darauf wurde Theodorakis von Neuem politischer Verfolgung ausgesetzt: Unter der Militärjunta musste er in den Untergrund gehen, er wurde verhaftet und ins KZ Oropos verschleppt. Während das – kurzlebige – Obristen-Regime Theodorakis und zahlreiche andere griechische Patrioten mit brutalen Mitteln einzuschüchtern und alle demokratisch-republikanischen Bestrebungen zu unterbinden suchte, widmete sich der 1969 in Frankreich erstmals aufgeführte Polit-Thriller „Z“ von Costa-Gavras – in Anspielung auf Ereignisse, die der Errichtung der Diktatur in Griechenland unmittelbar vorausgingen – einem Prozess der Aushöhlung der demokratischen Institutionen als Voraussetzung staatsterroristischer Machtausübung. Auch dieser Film, zu dessen Wirkung Theodorakis’ Musik entscheidend beitrug, kann als Mosaikstein der Geschichte der Befreiung Griechenlands – wie etwa zur gleichen Zeit Portugals und Spaniens – von den Überbleibseln des faschistischen Totalitarismus in Europa betrachtet werden.
1970 erzwang internationale Solidarität die Freilassung Theodorakis’, der sich zum zweiten Mal in französisches Exil begab. Indem er Pablo Nerudas Epos „Canto General“ vertonte, legte er auch ein Zeugnis von der engen Verknüpfung der Freiheitskämpfe des griechischen mit den Völkern Lateinamerikas ab. Während Neruda den Putsch Pinochets in Chile im September 1973 nur wenige Tage überlebte, konnte sein griechischer Freund 1974 in seine griechische Heimat zurückkehren. Dort wirkte er weiterhin aktiv an politischen Entscheidungsprozessen mit – und wurde zu einem nationalen Versöhner miteinander verfeindeter politisch-kultureller Lager. Ließ er sich zunächst für die Kommunistische Partei ins Parlament wählen, so kandidierte er 1990 erfolgreich für die Konservativen – und wurde Minister der Regierung Konstantinos Mitsotakis –, um später die Sozialisten zu unterstützen. Unabhängig von seinen (wechselnden) parteipolitischen Präferenzen war es ihm um einen „Zusammenschluß aller Erneuerungskräfte im Lande“ (Gunnar Decker) zu tun, um die nationale Unabhängigkeit und die in der griechischen Verfassung verankerten demokratischen und sozialen Errungenschaften zu verteidigen.
Auf der Ebene der internationalen Beziehungen stritt Theodorakis stets für eine Respektierung des internationalen Rechtes; die Kriege gegen Jugoslawien (1999) und den Irak (2003) verurteilte er scharf. Die Versöhnung zwischen Griechenland und der Türkei – und zwischen den griechischen und den türkischen Zyprern –, mithin auch eine Überwindung der Teilung Zyperns war ihm eine Herzensangelegenheit. In mehreren Statements wandte sich Theodorakis gegen geschichtsrevisionistische Bestrebungen auch auf der Ebene des Europarats, die von Nazideutschland und dessen Verbündeten ausgehenden Verbrechen gegen die Menschheit zu relativieren. Gemeinsam mit Manolis Glezos (* 9. September 1922; † 30. März 2020), der im Mai 1941 als junger Mann die von den Okkupanten auf der Akropolis gehißte Hakenkreuzflagge eingeholt hatte, protestierte er gegen eine Preisgabe griechischer Staatssouveränität und rief dabei in Erinnerung: „Als die SS und der Hunger eine Million Bürger umbrachten und die Wehrmacht das Land systematisch zerstörte, die Güter der landwirtschaftlichen Produktion und den Goldschatz der Banken raubte, retteten die Griechen mit der Gründung einer Bewegung der nationalen Solidarität das Volk vor dem Hungertod. Sie bildeten ein 100.000 Mann starkes Partisanenheer, welches 20 deutsche Divisionen in unserem Land zum Stehen brachte.“
Theodorakis’ Lebenswerk, in dem sich die unauflösliche Verflechtung des Kampfs um die Freiheit im eigenen Land mit der Perspektive der Freiheit Europas und der Menschheit verdichtet, erinnert nicht zuletzt auch an die ungeheuren Opfer, die Hellas im Verlaufe der vergangenen 100 Jahre für ein auf die Prinzipien der demokratischen Republik gegründetes Europa erbrachte.
* Erstveröffentlicht als In memoriam Mikis Theodorakis, in: EUROjournal pro management, Classic Edition 7/2021, 11.