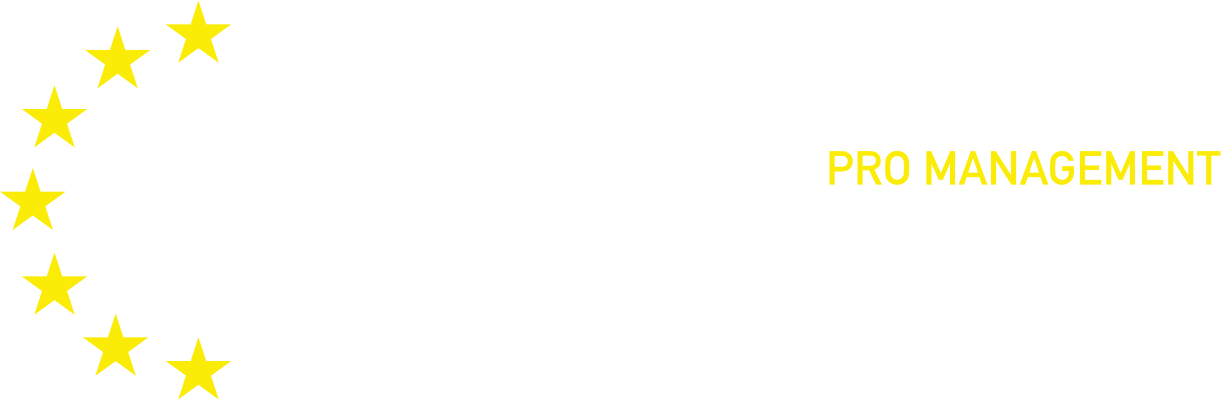In dem Band Mitte/Rechts. Die internationale Krise des Konservatismus (2024) führt Thomas Biebricher zur herausragenden Mitwirkung der UMP, genauer: Sarkozys identitätspolitischer Vorstöße in den 2010er Jahren an einer Konstellation, in der die Wahl des Front national (FN; heute: Rassemblement national, RN) schließlich weitgehend ‚normalisiert‘ wurde, u. a. aus:
„Aber diese umfassende Entdämonisierung, von der man eigentlich bis heute nicht genau sagen kann, ob sie die Partei substanziell verändert oder die radikalextremistischen Ecken und Kanten nur oberflächlich kaschiert hat, erklärt den Erfolg des FN nicht, sie war allenfalls die notwendige Bedingung. Das Set an hinreichenden Bedingungen lieferten vor allem Sarkozy und die UMP, und zwar durch eine fatale Kombination: Die UMP ließ sich gewissermaßen die Agenda vom FN diktieren und hatte sich spätestens in der heißen Phase des Wahlkampfs [der Präsidentschaftswahl 2012] fast ausschließlich auf Themen konzentriert, die zum Markenzeichen des FN gehörten: Einwanderung, Islamkritik, Identität. Damit wurde eine Vielzahl der FN-Positionen zumindest als erwägenswert legitimiert und entsprechend normalisiert. Andererseits hatte Sarkozy wie schon 2007 die unmissverständliche Order ausgegeben, es dürfe keinerlei formelle Zusammenarbeit mit dem FN geben, so dass die Partei weiterhin von politischen Ämtern ausgeschlossen blieb. Wie die Forschung zeigt, bietet genau diese Konstellation einen idealen Nährboden für rechtsautoritäre Parteien. Einerseits wird ihnen vonseiten der Mainstream-Parteien attestiert, eigentlich die richtige Agenda zu verfolgen; andererseits können sie sich im Status des Paria sonnen, der vom ‚System‘ daran gehindert wird, den Worten Taten folgen lassen zu können. Die Parteien der rechten Mitte erscheinen im Kontrast als Akteure, die zwar die Rechtsaußenthemen kopieren, diesen Worten aber keine Taten folgen lassen wollen. Und so leistete Sarkozys UMP einen beträchtlichen Beitrag zur droitisation, einer Rechtsverschiebung, die sich aus unzähligen Umfragen ablesen lässt.“
Nun haben – anders als die damalige UMP – deren deutsche Schwesterparteien CDU und CSU auch im jüngsten Wahlkampf nicht auf eine derartige Taktik des ‚Plagiierens‘ programmatischer Kernbestände der extremen Rechten zurückgegriffen, sie gerieten – wie zuletzt die Ergebnisse der Bundestagswahl zeigten – auch nie in eine Situation, in der sie hätten befürchten müssen, zwischen Parteien der äußersten Rechten und einem links von ihr stehenden Block ‚zerrieben‘ zu werden, wie es den Erben von Sarkozys UMP erging. Was allerdings durchaus ins Auge fällt – und punktuell an das erinnert, was in Frankreich als Krise des Parlamentarismus thematisiert wird –, ist eine zumindest rhetorische Polarisierung innerhalb der moderaten Kräfte (der ‚politischen Mitte‘ im weitesten Sinne), die eine Regierungsbildung auf der Grundlage stabiler parlamentarischer Mehrheiten künftig zumindest erschweren kann (wobei in Deutschland – im Unterschied zu Frankreich – Minderheitsregierungen, vor allem auf Bundesebene, keine politische Tradition haben und andererseits die Option einer Großen Koalition von SPD und Union nach wie vor nicht als ‚verbrannt‘ gilt, wohingegen es in Frankreich der Regierung des Christdemokraten Bayrou bis heute nicht gelungen ist, neben den Mitte/Rechts-Formationen auch moderate Kräfte der politischen Linken in eine lagerübergreifende Regierungsbildung einzubeziehen).
Werden auch in Frankreich auf der einen Seite nicht ohne Unbehagen die relativen Wahlerfolge einer rechtsextremen deutschen Partei zur Kenntnis genommen, deren Repräsentanten die Geschichte des „Dritten Reiches“ trivialisieren und ihr Desinteresse an der deutsch-französischen Freundschaft ostentativ zur Schau stellten (weshalb es Marine Le Pens RN war, der im Kontext des AfD-Europawahlkampfes eine Art Brandmauer [cordon sanitaire] auf der Ebene der Kooperation im EU-Parlament errichtete), so gibt auf der anderen Seite Merz’ Besuch in Paris drei Tage nach seinem Wahlsieg Hoffnung auf einen substantiellen Ausbau der deutsch-französischen Beziehungen. Einem solchen Prozess könnte zugutekommen, dass der künftige Kanzler mit Premierminister Bayrou – und in gewisser Hinsicht auch mit Präsident Macron – nicht nur die politisch-kulturellen Bindungen an einen ‚proeuropäischen‘ Liberalkonservatismus teilt, sondern auch bereit ist, einschlägige energiepolitische Sonderwege zu revidieren – oder zumindest zu relativieren –, zumal er die allgemeine Technologieskepsis eines Teils der einstigen Ampelkoalition, die Deutschland in den vergangenen Jahren in der EU der Tendenz nach isolierte, ebenso wenig teilt wie die Mehrheit der Franzosen und deren politische Klasse.