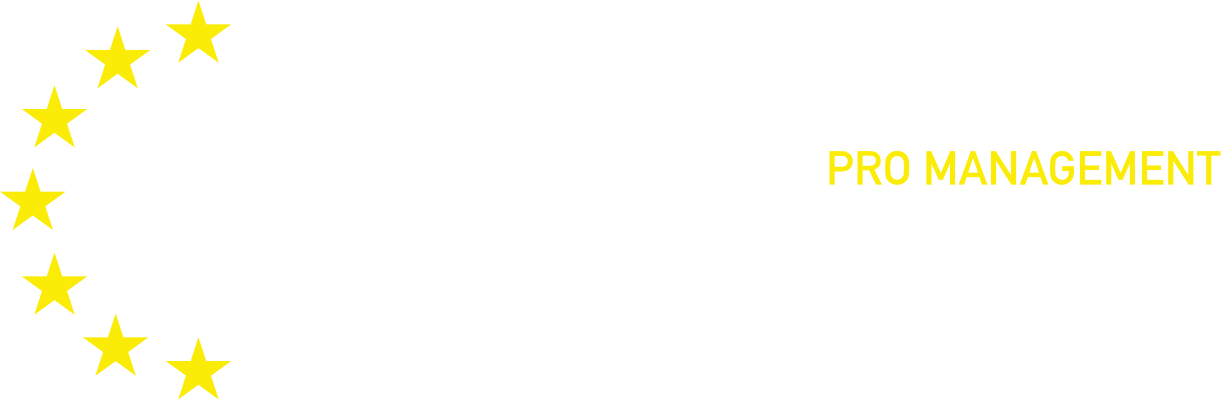Warum die Territorialfrage die Ostflanke der NATO nervös hält
Der Donbass ist ein Landstrich, aber längst kein bloßer Ort mehr. Er ist ein Begriff geworden, ein Prüfstein, eine Art politischer Lackmustest für die Frage, ob Europa seine Ordnung noch für stabil hält – oder ob es sich an die Vorstellung gewöhnen muss, dass Grenzen wieder verhandelbar sind, nicht am Kartentisch, sondern mit Gewalt. Wer dieser Tage über den Krieg in der Ukraine spricht, landet früher oder später beim Donbass, weil sich in dieser Region wie unter einem Brennglas bündelt, was der Krieg im Kern ist: ein Kampf um Territorium, um Souveränität und um die Regeln, nach denen dieser Kontinent funktionieren soll.
Ende Januar 2026 trafen sich Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA in Abu Dhabi zu Gesprächen. Allein das Format wirkt wie ein Signal: Washington vermittelt, Kyjiw sitzt mit Moskau an einem Tisch, und irgendwo zwischen höflichen Floskeln und harten Positionen schimmert die Möglichkeit auf, dass dieser Krieg irgendwann doch in einen politischen Prozess überführt werden könnte. Doch wer in diesen Tagen nach einer „Wende“ sucht, findet vor allem eine Erkenntnis: Selbst Diplomatie ist in diesem Krieg kein Gegenentwurf zur Gewalt, sondern oft nur ihre Begleitmusik. Denn während über Rahmenbedingungen gesprochen wurde, blieb die militärische Realität bestehen – Angriffe, Zerstörung, Druck auf Städte und Infrastruktur. So entsteht jene eigentümliche Gleichzeitigkeit, die Europas Sicherheitslage so nervös macht: Es wird verhandelt, aber nicht entlastet. Es wird gesprochen, aber nicht abgerüstet.
Im Zentrum dieser Gespräche stand, wie so oft, die Territorialfrage. Russland, so berichten es internationale Medien, beharrt darauf, dass es nicht um Kompromisse im klassischen Sinn geht, sondern um Anerkennung dessen, was Moskau als „Realität“ betrachtet: Kontrolle über den Donbass, am besten vollständig, am besten dauerhaft. Die Ukraine kann das nicht akzeptieren, weil es nicht nur ein Stück Land wäre, das man aufgibt, sondern das Prinzip, auf dem die eigene Existenz als Staat beruht. Und so kreist alles um denselben Knoten: Wer glaubt, dass ein Frieden möglich ist, muss erklären können, wie er aussehen soll, ohne dass er wie eine Belohnung für den Angriff wirkt.

Foto: Pixabay_Servetphotograph_matryoshka-6902296_1920
Das klingt nach juristischen Feinheiten, ist aber in Wahrheit die große politische Frage unserer Zeit. Denn der Donbass ist nicht nur ukrainisches Territorium, er ist die Bühne, auf der Europa seine eigene Zukunft verhandelt. Wenn ein Angreifer Gebietsgewinne in Gesprächen als Ausgangspunkt setzt, dann verschiebt sich der Maßstab: von der Unverletzlichkeit der Grenzen hin zu einer Welt, in der sich Gewalt in Verhandlungsmacht verwandelt. Für Länder wie Polen, Litauen oder Rumänien ist das keine theoretische Debatte. Es ist die Angst, dass ein Präzedenzfall entsteht – einer, der nicht bei der Ukraine endet, sondern das strategische Denken in ganz Ost- und Mitteleuropa verändert. Vielleicht erklärt das auch, warum die Ostflanke der NATO in diesen Wochen weniger nach „Entspannung“ aussieht als nach Verdichtung. Die Allianz verstärkt ihre Präsenz, baut Fähigkeiten aus, plant langfristiger. Deutschland etwa setzt mit dem Aufbau einer Brigade in Litauen nicht nur ein politisches Zeichen, sondern schafft eine Struktur, die auf Dauer angelegt ist: Abschreckung als Alltag, nicht als Ausnahmezustand. Das ist eine stille, aber weitreichende Verschiebung. Nicht mehr die schnelle Reaktion auf eine Krise steht im Vordergrund, sondern die Annahme, dass Krisenlage der neue Normalzustand sein könnte.
Polen wiederum reagiert mit einer anderen, ebenso konsequenten Logik: Wenn dieser Krieg etwas gezeigt hat, dann wie stark sich moderne Bedrohungen in die Luft verlagert haben. Drohnen, Raketen, hybride Zwischenfälle – all das verändert die Frage, was „Grenze“ überhaupt bedeutet. Grenze ist nicht mehr nur ein Zaun oder ein Fluss, sondern ein Raum, der überwacht, geschützt, verteidigt werden muss. Warschau kündigte deshalb den Ausbau großer Drohnenabwehr-Kapazitäten an, ein Vorhaben, das in seiner Dimension nicht nur nationale Sicherheitspolitik ist, sondern ein Statement: Wer an der Schnittstelle zur direkten Bedrohung lebt, kann sich keine strategische Romantik leisten.
So entsteht zwischen Berlin und Warschau, trotz aller politischen Reibungen, eine Art unfreiwillige Gemeinsamkeit. Deutschland bringt Gewicht und Struktur in die Bündnisarchitektur ein, Polen Tempo und Dringlichkeit, beide zusammen sind Teil einer Ostflanke, die nicht mehr nur auf Panzerkolonnen schaut, sondern auf Sensorik, Luftverteidigung, Resilienz. Abschreckung wird technischer, kleinteiliger, nervöser. Und vielleicht ist das der ehrlichste Ausdruck dessen, was dieser Krieg mit Europa gemacht hat: Er hat das Sicherheitsdenken vom Ausnahmezustand in die Dauerverwaltung verschoben. In Abu Dhabi wurde, wenn man so will, über die Möglichkeit gesprochen, den Krieg politisch einzufangen. Aber die Forderung nach dem Donbass zeigt, warum das so schwer ist. Solange Territorium nicht als Ergebnis eines fairen Prozesses, sondern als Vorbedingung eines Deals auf dem Tisch liegt, bleibt jeder Friedensversuch fragil. Und solange parallel weiter angegriffen wird, bleibt Diplomatie ein Raum ohne Schutzwirkung – ein Ort, an dem man reden kann, ohne dass draußen die Waffen schweigen müssen.
Der Donbass ist damit mehr als ein Frontabschnitt. Er ist die Frage, wie Europa künftig leben will: in der Hoffnung, dass Regeln wieder gelten, oder in der Vorbereitung darauf, dass sie jederzeit gebrochen werden können. Vielleicht ist das die eigentliche Bitterkeit dieses Moments: Frieden ist derzeit kein Zustand, den man verhandelt, sondern ein Risiko, das man kalkuliert. Und die Ostflanke – von Litauen bis Polen – handelt so, als dürfe man sich bei dieser Kalkulation keinen Fehler erlauben.