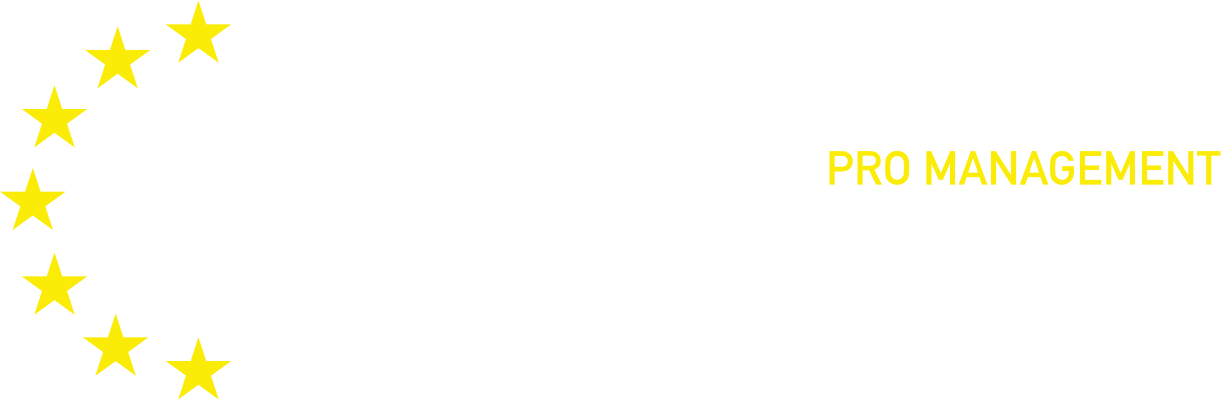Nachdem die Minderheitsregierung des Konservativen Michel Barnier bereits nach drei Monaten im Amt daran gescheitert war, den Block der Linken und die äußerste Rechte von Marine Le Pens Rassemblement National wenigstens daran zu hindern, sie gemeinsam durch ein Misstrauensvotum in der Nationalversammlung zu Fall zu bringen, verband sich mit der Persönlichkeit von Barniers Amtsnachfolger François Bayrou die (nicht gänzlich unbegründete) Hoffnung, dass es ihm gelingen könnte, die moderaten Kräfte „von den Kommunisten über die Sozialisten bis zu den Republikanern“ (FAZ, 14.12.2024) für einen „Nichtangriffspakt“ zu gewinnen. Dies verband sich mit der Erwartung, der neue Premierminister – ein Christdemokrat, der sich selbst als Prototyp eines sowohl zur Rechten als auch zur Linken hin im Prinzip dialogfähigen Zentristen versteht – vermöchte es, auch die gemäßigten linken Parteien (abseits der sich aggressiv staatsfeindlich gebärdenden Linkspopulisten von Jean-Luc Mélenchons LFI) nach Möglichkeit in die Regierungsneubildung einzubeziehen; immerhin hatten auch diese drei Parteien (die SPD-Schwesterpartei PS, die Kommunisten und die Grünen) signalisiert, an einem modus vivendi interessiert zu sein.
Gemessen an solchen Hoffnungen oder Erwartungen stellt sich Bayrous nun vorgestelltes Kabinett als recht enttäuschend dar. Es ist in wesentlichen Teilen nämlich mit jenem Barniers identisch (Außenminister Jean-Noël Barrot, Kulturministerin Rachida Dati…), eine gewisse Öffnung nach „links“ manifestiert sich lediglich in der Ernennung des früheren Bürgermeisters von Dijon, François Rebsamen, zum Minister für Dezentralisierung und des einstigen Premierministers Manuel Valls zum Minister für die Überseegebiete. Keiner dieser beiden aus der Sozialdemokratie stammenden Politiker ist repräsentativ für eine der gegenwärtigen Linksparteien, wobei der PS-Renegat Valls sich, nachdem er dem politischen Leben Frankreichs brüsk den Rücken gekehrt hatte, zeitweilig sogar an Kampagnen der spanischen Rechten im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den katalanischen Separatismus in Barcelona beteiligte.
Den mangelnden Rückhalt seiner Regierung in der demokratisch-republikanischen Linken musste und muss Bayrou unvermeidlicherweise ausgleichen durch gewisse Konzessionen an den rechtsnationalen RN. Personalpolitisch kommt dies bereits zum Ausdruck im Festhalten an Innenminister Bruno Retailleau, der den rechten Pol der Republikaner (also der rechtsbürgerlichen Schwesterpartei der CDU/CSU, der auch Barnier angehört) personifiziert. Der moderate Republikaner Xavier Bertrand ist demgegenüber in Bayrous Kabinett nicht vertreten, auch dies ein Zugeständnis an Le Pen.
Perspektivisch ergibt sich aus der von Bayrou repräsentierten Regierung allerdings etwas, was die liberal-republikanische Marianne in ihrer aktuellen Ausgabe mit dem Satz: „La vraie cohabitation commence“ zum Ausdruck brachte. Nun steht eine cohabitation in der französischen Verfassungswirklichkeit für einen Zustand, in dem aufgrund des Fehlens einer parlamentarischen Mehrheit für den Staatspräsidenten dieser sich auf eine (ansonsten in Frankreich eher unübliche) lagerübergreifende Ausgestaltung der Exekutive einlässt, indem er einen Premierminister, der einem anderen Lager angehört, ernennt. Insofern bringt cohabitation stets eine gewisse ‚Parlamentarisierung‘ des semipräsidentiellen Regierungssystems Frankreichs mit sich. Premierminister Bayrou und seine Partei MoDem sind zwar integraler Bestandteil des politischen Lagers des Staatspräsidenten, allerdings steht Bayrou in dem Ruf, Macron seine Ernennung zum Premierminister aufgenötigt zu haben (durch Drohung mit einem Rückzug des MoDem aus dem zentristischen Parteienbündnis Ensemble pour la République). Länger als Barnier wird Bayrou, der wirtschafts- und sozialpolitisch der Sozialdemokratie nicht allzu fernsteht, als Regierungschef nur überleben können, wenn er Macrons in gewisser Hinsicht autoritärem Zentrismus einen liberal-demokratischen, auf Ausgleich mit der gemäßigten Linken und dem sozialen Konservatismus bedachten Zentrismus entgegenstellt.
Von Kollegiumsmitglied Daniel L. Schikora