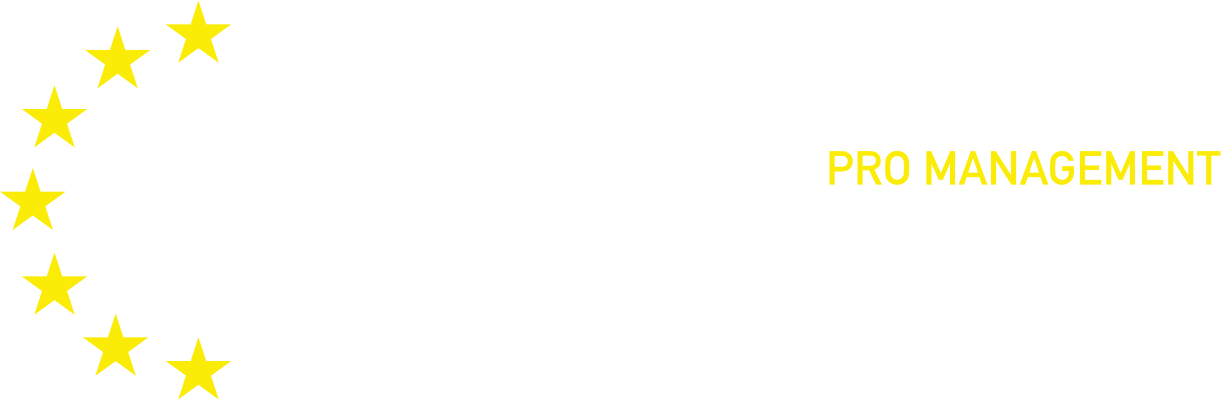Es gibt Abhängigkeiten, die man spürt – und jene, die man erst bemerkt, wenn die Regale leer sind. Zu den letzteren zählt die pharmazeutische Versorgung Deutschlands sowie Europas. Die eigene pharmazeutische Souveränität ist über Jahrzehnte leise erodiert. Deutschland, einst stolz auf seine chemisch-pharmazeutische Tradition, ist heute in bedenklichem Maße von ausländischen Produzenten abhängig. Die Pandemie war ein Vorgeschmack darauf. Die jüngsten Lieferengpässe bei Kinderantibiotika, Insulinen oder ADHS-Präparaten sind kein Betriebsunfall, sondern Symptom eines Systems, das über Jahre auf Preis statt auf Resilienz gesetzt hat. Während Europa gern über strategische Autonomie debattiert, liegt die eigentliche Verwundbarkeit in kleinen weißen Tabletten – deren Herkunft selten in Europa, dafür umso häufiger in Fernost liegt. Diese Tatsache ist nicht neu, aber ihre geopolitische Bedeutung wird erst jetzt schmerzhaft sichtbar.

Themenbild-Quelle: Pixabay_stevebp_apothecary
Die Ursachen sind hausgemacht. Die „Geiz-ist-geil“-Mentalität der 2000er- und 2010er- Jahre, flankiert von aggressiven Rabattverträgen der Krankenkassen und einem politisch gewollten Preiswettbewerb, hat Europas Produktionsstätten ausgedünnt. Während hierzulande Fabriken schlossen, bauten China und Indien ihre Kapazitäten massiv aus. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA bezifferte 2023, dass mehr als die Hälfte der Zulieferbetriebe für kritische Wirkstoffe inzwischen in Asien sitzt. Selbst Medikamente, die in den USA oder Indien final verpackt werden, sind abhängig von chinesischen Molekülbausteinen. Die globale Apotheke steht längst nicht mehr in Basel oder Berlin, sondern in Guangdong und Gujarat.
Diese Verlagerung wäre ein überschaubares Problem, hätte sie nicht eine gefährliche Vernetzungsabhängigkeit geschaffen. Die COVID-19-Pandemie legte mit brutaler Klarheit offen, wie fragil diese Ketten inzwischen sind. Ein einziger Produktionsausfall in Fernost stellte plötzlich ganz Europa auf die Probe. Deutschland verzeichnete zeitweise rund 500 Lieferengpässe – von Kinderantibiotika über ADHS-Mittel bis zu Asthma-Sprays. Die Lage gleicht einem System, das noch funktioniert, aber unter permanentem Druck steht. Ein Fehler im Getriebe, und die Gesundheitsversorgung gerät ins Schlingern.
Dabei geht es längst nicht mehr nur um Ökonomie, sondern um Geopolitik. China hat in anderen Sektoren gezeigt, wie geschickt es wirtschaftliche Abhängigkeiten als Druckmittel einsetzt – etwa im Konflikt um seltene Erden mit den USA. Wer glaubt, Peking würde ausgerechnet bei pharmazeutischen Wirkstoffen Zurückhaltung üben, unterschätzt den strategischen Spielraum, den globale Lieferketten heute bieten. Europa hat mit seiner Sparpolitik die Grundlage dafür geschaffen, dass ein einziger Staat eine enorme Hebelwirkung auf seine Gesundheitsversorgung hat.
Doch nun beginnt ein Umdenken. Die Europäische Kommission hat ein Gesetzespaket vorgelegt, das als europäische Antwort auf die strukturellen Schwachstellen verstanden werden kann. Es ist kein Rundumschlag, aber ein ernst zu nehmender Versuch, die Abhängigkeit zu verringern und die eigene Resilienz zu stärken. Zum ersten Mal wird die Versorgungssicherheit mit kritischen Arzneimitteln als strategisches Ziel definiert – ähnlich wie Energie- oder Verteidigungssicherheit. In Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen wird pharmazeutische Sicherheit damit zur Frage europäischer Selbstbehauptung.
Der Vorschlag der Kommission umfasst mehrere Elemente, die zusammen ein neues Paradigma markieren. Öffentliche Vergaben sollen nicht länger allein den günstigsten Anbieter bevorzugen, sondern denjenigen, der in Europa produziert und stabile Lieferketten vorweisen kann. Es ist ein „Buy European“-Prinzip, das nicht protektionistisch, sondern realistisch ist: Ein paar Cent Einsparung pro Packung haben sich als politischer Luxus entpuppt, den sich Europa nicht mehr leisten kann. Daneben sollen strategische Projekte gefördert, Genehmigungsverfahren beschleunigt und gemeinsame EU-Beschaffungen für besonders knappe Arzneimittel ermöglicht werden – ein Ansatz, der an das erfolgreiche Impfstoffmodell der Pandemie erinnert.
Gleichzeitig ist klar, dass Europa nicht in die Industrie der 1980er-Jahre zurückkehren kann. Die Herstellung chemischer Grundstoffe ist in Asien um ein Vielfaches günstiger, und der Wiederaufbau europäischer Produktionsketten würde Jahre dauern. Das Budget des Gesetzespakets – 83 Millionen Euro – ist eher ein politisches Signal als ein finanzieller Durchbruch. Und selbst eine europäische Fertigung bleibt abhängig von globalen Vorprodukten, von denen viele weiterhin überwiegend in China entstehen. Autarkie ist also keine Option, aber Autonomie im Sinne von Resilienz durchaus.
Die eigentliche Chance Europas liegt ohnehin nicht in billiger Massenproduktion, sondern in technologischer Führungsfähigkeit. Moderne biotechnologische Herstellungsverfahren, dezentrale Synthesemodelle, KI-optimierte Produktionsprozesse – das sind die Felder, in denen Europa traditionell stark ist und in denen es wieder punkten könnte, wenn es die richtigen Weichen stellt. Die WHO spricht in diesem Zusammenhang von „regional resilience clusters“ – regionalen Kompetenzzentren also, die Abhängigkeiten nicht abschaffen, aber deutlich reduzieren können.
Europa steht somit an einem Wendepunkt. Die Abhängigkeit von China ist kein Schicksal, sondern das Resultat politischer Entscheidungen – und kann daher durch neue Entscheidungen gemildert werden. Die EU-Kommission hat den ersten Stein ins Wasser geworfen, doch die Wellen werden nur Wirkung entfalten, wenn die Mitgliedstaaten bereit sind, mitzuschwimmen: mit Investitionen, mit politischen Prioritäten, mit der Anerkennung, dass Gesundheit nicht billig sein darf, wenn sie sicher sein soll.
Die Frage der pharmazeutischen Souveränität entscheidet nicht über die Preise im Apothekenregal, sondern über Europas strategische Position in einer fragileren Welt. Die Zukunft wird nicht fragen, wer das billigste Antibiotikum produzieren konnte – sondern wer es noch hat, wenn die Lieferketten erneut ins Wanken geraten.